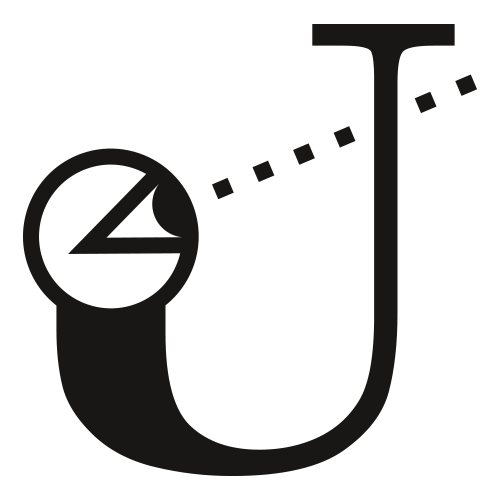haben Caroline gesehen.
Diesen kurzen Satz wollen wir erst einmal so stehen lassen, wollen ihm ermöglichen, eine Wirkung zu entfalten. Verhallt er wirkungslos, evoziert die Photographie vielleicht (trotzdem) auch etwas, irgendetwas.
Ich weiß, dass ich gerne undeutlich bin, doch Sie sollten/müssten wissen, dass diese Undeutlichkeit im Regelfalle dosiert ist, fein dosiert ist und Ihr Denken herauslocken, herausfordern soll. Nur so kann ich mich Ihnen nähern, nur so perlt meine Rede nicht ab, verhält sich zu Ihrem Bewußtsein, wie das Wasser zum Lotus.
Und Sie wollen doch auch, dass Text Sie berührt, sich nicht in Phrasen und Floskeln ergeht, die ihn austauschbar, überflüssig machen – zurück zum Satz, zurück zum Bild. Hier herrscht große Undeutlichkeit, steckt die Bedeutung in einem Labyrinth, und es braucht einen langen (zarten und blauen) Faden, die Bedeutung zu erschließen. Alternativ hilft auch das Tauchen, aber wer versteht schon, richtig einzutauchen?
»Seine Augen haben Caroline gesehen« – so, so, seine Augen – wessen Augen?
Die Augen von Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling.
Und wir sehen seine Augen, weil das Bild 1848 entstand, zu einer Zeit, als die Photografie schon Einzug in die Welt genommen hat. Und der Augen der beiden Damen konnte man zu dieser Zeit bereits nur noch über Zeichnung und Malerei gewahr werden. Über das Erinnern der Augen-Blicke wollen wir jetzt und hier nicht sprechen, es führte zu weit.

Zur Rechten sehen wir Caroline, sieht uns Caroline. Ich schweife ab und zitiere so lange aus einer Mail, die damals noch nichts davon wusste, dass ich sie hier zweitverwerte – ich wusste es doch auch nicht.
»Wie sich mein Blick doch wandelt. Ich spiele mit dem Gedanken, den Umschlag der »Lucinde« erneut anzupassen, Caroline unter Dorothea zu legen oder umgekehrt – vielleicht lege ich mir ein weiteres Exemplar der … Bevor der Gedanke formuliert ist, gerinnt er mir in Wirklichkeit. Wieder wird mir die Ausgabe von Goldmann geschickt, wieder werde ich das Cover, die Sängerin, überkleben, die Sängerin unter der Rhapsodin übergibt an die Rhapsodin – die Nymphe zeigt sich—selbst. Ach, es gibt ja ausreichend Exemplare dieses Taschenbuchs. Soll ich nicht ein weiteres bestellen, Katharina auch auf sich selbst kleben, die Sängerin auf die Sängerin, ihr Raum geben? Stieler, der in Mainz geboren, hat ihrem Bild doch auch mehr Raum geboten, hat Katharina sich entfalten lassen, zeigt den ganzen Hals, nackte Schulter, zeigt sie, bevor sie sich für vierundvierzig Jahre zurückziehen wird – und 1877 kurz vor Philipp Veit stirbt. Reduziert das Punktum nicht in die Perle, und ist es die Perle, lasst es reicher, lasst es voller sein! Goethe und Schelling hat Stieler doch auch mehr Raum gegeben. Ich schweife ab«
Ich bin zurück, lese mein Zitat und fühle mich in der Pflicht. Die Katharina, von der hier die Rede ist, ist Katharina Sigl-Vespermann. In Wikipedia findet sich ein Beitrag » zu ihr. Ganz unabhängig vom Beitrag findet sich – ebenfalls in der Wikipedia – auch ein Bild von ihr. Leider ist dem Beitrag kein Bild zugefügt, aber eines liegt hier » auf den Servern der Wikimedia.